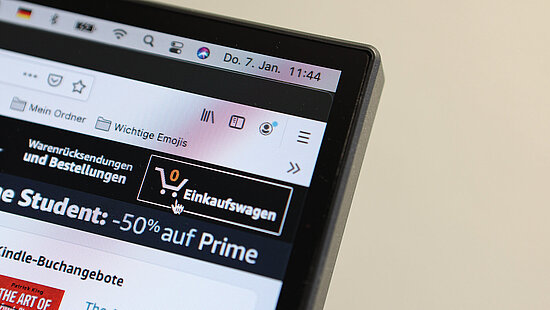Zwar scheint Licht am Ende des Tunnels, aber es wird noch dauern, bis die Corona-Pandemie tatsächlich überwunden ist. Schon jetzt ist aber klar: Covid-19 war eine Herausforderung, die Staat, Wirtschaft und Gesellschaft an die Grenzen geführt hat. Dass dabei auch Fehler gemacht wurden, ist per se weder verwunderlich noch verwerflich. Insofern wäre zu wünschen, dass dem Ende der Pandemie eine zwar schonungslose, gleichzeitig aber sachliche und ruhige Analyse folgt. Es geht nicht darum, jemanden auf die Anklagebank zu setzen – und schon gar nicht darum, Sündenböcke zu finden. Das Ziel ist schlicht, dass alle für die Zukunft etwas lernen. So versteht sich dieser Beitrag als Zwischenbilanz, und wenn ich mit dieser auf Widerspruch stoßen sollte – dies ist ausdrücklich gewollt. Nur der Widerstreit von Meinungen ermöglicht letztlich einen inhaltlichen Fortschritt. Dialektik nannten das die großen Denker.
Das fängt im Kleinen am. Beginnen wir also bei uns selbst: Unser Leben wurde zwangsweise entschleunigt. Das hatte mitnichten nur Nachteile. Plötzlich kommen Dinge in den Blick, die vorher der allgemeinen Hektik und dem beruflichen Stress zum Opfer fielen. Wenn alles ein wenig langsamer laufen würde, kommt man also auch zum Ziel, vielleicht sogar etwas weniger oberflächlich. Mir ist die bewegende Video-Botschaft des mexikanischen Nationalpräses Padre Saúl Ragoitia Vega vom April 2020 noch gut vor Augen, in der er sagte, wir würden unsere persönlichen Begegnungen ganz neu schätzen lernen, wenn alles einmal vorbei sei. Bleibt es also dabei, dass wir uns nur darauf freuen, wieder einmal einen kräftigen Händedruck austauschen oder jemanden in den Arm nehmen zu können? Oder bedeutet Empathie in Wirklichkeit nicht doch, dass ein kurzes gutes Wort an das Gegenüber mehr wert wäre, als ein hastiges „Wie geht’s?“, das die Antwort schon gar nicht mehr abwartet, weil die gleiche Frage bereits dem Nächsten gestellt wird? Klingt vielleicht trivial, aber das Nachdenken lohnt.