"Das Judentum ist so vielfältig. Sie werden so viele Meinungen und Perspektiven finden, wie es auch Jüdinnen und Juden gibt." Die Worte von Ruth Schulhof-Walter sind eindringlich. Mit fester Stimme spricht sie überzeugt und routiniert in die Zoom-Kamera; sie erzählt oft vom Judentum. Ruth Schulhof-Walter ist Jüdin. Sie wohnt in Köln und arbeitet dort in der Verwaltung der Synagogen-Gemeinde. Neben ihrer hauptberuflichen Tätigkeit ist sie seit Sommer 2019 Vorstandsmitglied des Vereins „321-2021: 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“. Der Name ist Programm. Auf das Jahr 321 reicht der erste schriftliche Beleg für die Existenz von Juden auf deutschem Boden zurück. Da unterzeichnete der römische Kaiser Konstantin ein Edikt, in dem erstmals die Berufung von Juden in den Kölner Stadtrat gestattet wurde.
Jüdische Vielfalt zwischen Akzeptanz und Ignoranz
Deutschland blickt in diesem Jahr auf 1.700 Jahre jüdisches Leben zurück. Aber was bedeutet das heute? Das erzählen vier Jüdinnen und Juden.
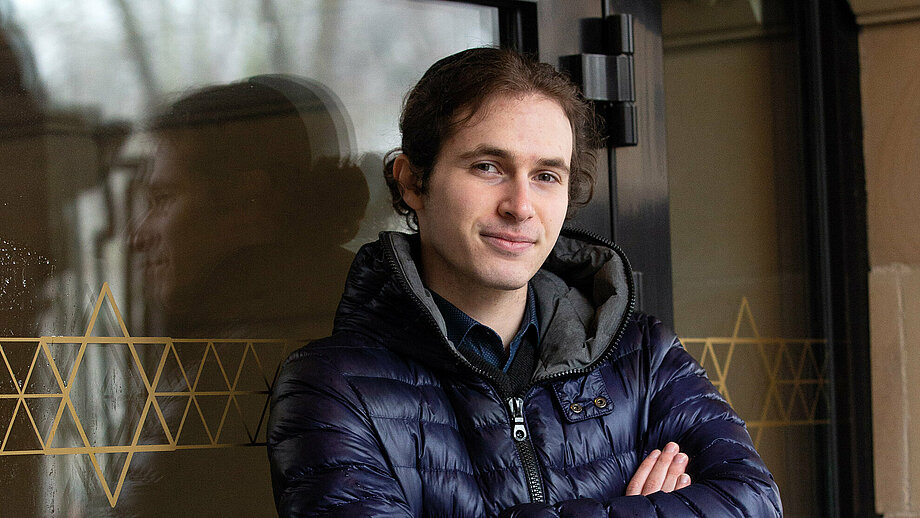
Jüdisches Leben sichtbar machen
Um jüdisches Leben heute – 1.700 Jahre später – sichtbar zu machen, organisieren in diesem Jahr bundesweit Vereine, Initiativen und Gemeinden ein ganzes Jahr lang vielfältige Veranstaltungen aus den Bereichen Kunst und Kultur, politische und kulturelle Bildung, Religion, Tradition oder Zivilgesellschaft. Auch das Kolpingwerk Deutschland widmet sich in diesem Jahr dem Judentum. Im Kontext der Kölner Gespräche war Josef Schuster Anfang März zu Gast – der Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland. Er selbst zählt zu den Gründungsmitgliedern des Vereins zum Festjahr. Es dürfe aber nicht mit einem Jubeljahr verwechselt werden, machte Schuster in seiner Rede deutlich. Denn jeder, der sich mit der jüdischen Geschichte in Deutschland beschäftigt, wisse, dass sie von Höhen und Tiefen geprägt ist. „Nicht nur von Tiefen – von tiefsten Abgründen!“ Dass der auch von ihm mitgegründete Verein dennoch ein Festjahr ausruft, halte er aber für richtig. Es gehe nämlich darum, „in Deutschland ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wie lange bereits Juden in deutschen Landen leben, wie sehr sie die Kultur unseres Landes geprägt haben und wie sich das jüdische Leben heute gestaltet.“
Wirklich sichtbar ist es in der Gesellschaft bislang eher selten. Auf rund 83 Millionen Einwohner in Deutschland kommen heute bundesweit rund 100.000 jüdische Gemeindemitglieder. Das sind weniger als ein Prozent der deutschen Bevölkerung. Zum Vergleich: Vor der Machtübernahme der Nationalsozialisten im Jahr 1933 hatten die jüdischen Gemeinden im damaligen Deutschen Reich rund 560.000 Mitglieder bei insgesamt rund 65 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern. Vermutlich haben sich die wenigsten Nicht-Juden schon einmal bewusst mit einer jüdischen Mitbürgerin oder einem Mitbürger unterhalten. Viele kennen das Judentum nur aus den Geschichtsbüchern der Schule: Antisemitismus und die Schoah – die Assoziationen sind bei den meisten ähnlich. Ruth Schulhof-Walter stört das: „Ja, 13 Jahre gab es die Schoah und das ist schrecklich. Aber es gibt so viel mehr, und uns nur auf diese Episode zu beschränken, ist falsch.“ Auch aus diesem Grund engagiert sich die 66-Jährige im Verein „321-2021“. „Wir wollen zeigen, wie wir leben. Und auch, dass das im Grunde nicht so anders ist. Es ist schwierig, den Menschen zu vermitteln, dass wir genauso sind wie alle anderen – ja, wir haben andere Traditionen und andere Rituale, die aber auch jeder Jude anders lebt. Aber ich esse, ich arbeite, ich fahre Auto, ich fluche an der roten Ampel und ich zahle Steuern.“ Schulhof-Walter zuckt mit den Achseln. Wie oft sie das bereits erklärt hat, ist nur zu erahnen.
Sprung in die Öffentlichkeit
Lebendiges jüdisches Leben ist nicht immer auf den ersten Blick zu finden. Oft finden jüdische Veranstaltungen unter Polizeischutz, großen Sicherheitsmaßnahmen und hinter verschlossenen Türen statt. Über 2.000 antisemitische Straftaten wurden in Deutschland im vergangenen Jahr gezählt. Jüdisches Leben in die breite Gesellschaft zu tragen, gestaltet sich oft als schwierig – zu riskant, zu gefährlich. In den Gemeinden und jüdischen Vereinen schwingt immer ein Stück weit Angst mit. Und trotzdem gibt es viele Juden und Jüdinnen, die an die Öffentlichkeit gehen. Auch Ruth Schulhof-Walter vollführt diesen Balanceakt seit Jahrzehnten. „Ich bin mir der Gefahr dessen sehr bewusst. Ich kann aber auch nicht immer anonym bleiben. Wenn ich etwas erreichen will muss ich auch den Sprung in die Öffentlichkeit wagen.“
Den Sprung in die Öffentlichkeit hat auch Aaron Knappstein gemacht. Einen Großteil des Jahres führt er ein ganz unauffälliges Leben: Er arbeitet im Bereich der Personalvermittlung und lebt mit seinem Partner am Rand von Köln. Zwischen dem 11. November und Aschermittwoch streicht er jedoch die erste Silbe im Wort „unauffällig“. Denn dann schlägt sein Herz wahrscheinlich nicht mehr im Sinusrhythmus – sondern im Takt der Kölner Karnevalslieder. Gerade aus der Domstadt sind die jecken Tage ebenso wenig wegzudenken, wie die Farben Schwarz und Orange aus dem Kolpingverband. Kein Wunder, dass Knappstein als gebürtiger Kölner dem Karneval schon seit Kindesbeinen an verfallen ist. Seit einigen Jahren spielt für ihn auch seine jüdische Identität in der Karnevalszene eine Rolle. Er ist der Vorsitzende des Ende 2017 gegründeten jüdischen Karnevalvereins „Kölsche Kippa Köpp“. Für das jüdische Leben in der Öffentlichkeit ist das eine Erfolgsgeschichte. Nach der Gründung gab es großes internationales Presseecho und viel positive Resonanz. Knappstein erklärt sich den Erfolg des Vereins unter anderem so: „Wir machen etwas, was in Köln sehr verwurzelt ist, und schaffen es so, jüdisches Leben in die Gesellschaft hineinzutragen. Das schafft kein jüdischer Sportverein und auch keine jüdische Kulturgemeinde – leider, muss man dazu sagen.“
Karneval verbindet
Einen jüdischen Karnevalsverein gab es bereits Anfang des 20. Jahrhunderts. Der „Kleine Kölner Kegelklub“ wurde 1922 ins Leben gerufen und löste sich während des Nationalsozialismus auf Druck von außen hin auf. Der Präsident des Festkomitees Kölner Karneval, Christoph Kuckelkorn, war vor einigen Jahren der Meinung, dass ein Mosaikstein in der Karnevalsszene fehle, der mit der Gründung der „Kölsche Kippa Köpp“ wieder eingefügt wurde. Die Karnevalssitzung „Falafel und Kölsch“ fand mit rund 200 Personen in den Räumen der Kölner Synagogengemeinde statt. „Die Sitzung hätten wir im Prinzip dreimal so groß machen können, so groß war der Andrang“, erzählt Knappstein. Der Verein selbst zählt inzwischen knapp 80 Mitglieder: orthodoxe, liberale und nicht religiöse Juden und Jüdinnen, aber auch nicht-jüdische Mitglieder. Knappstein findet das gut. „Es kommt automatisch zu Begegnungen und das ist wertvoll.“ Er erzählt von einer nicht-jüdischen Frau, die Mitglied im Verein geworden ist. Nachdem in der gemeinsamen WhatsApp-Gruppe zum Pessach-Fest gratuliert wurde, fragte sie interessiert, was Pessach eigentlich sei. Gegenseitiges Interesse ist auf jeden Fall da. Und trotzdem muss Knappstein nach außen immer wieder klarstellen: „Wir feiern keinen jüdischen Karneval, weil es den nicht gibt – wir feiern Kölner Karneval als Juden!“
Der 50-Jährige greift in seine Jackentasche und holt ein Stück Stoff in den Farben weiß und blau heraus. Beim Aufklappen wird erkennbar, was Aaron Knappstein in den Händen hält. Es ist die Narrenkappe der „Kölsche Kippa Köpp“. Blau und Weiß sind die Farben Israels. Aufziehen möchte Knappstein die Kappe nicht. Schließlich sei gerade keine Karnevalszeit. Was auf der Kappe aufgedruckt ist, erklärt er trotzdem. Auf der Innenseite sind der Davidsstern und die Menora, der siebenarmige Leuchter, abgebildet. Außen ist das Logo des Vereins zu erkennen. Die Kappe trägt Knappstein nur zu einer bestimmten Zeit, genauso wie seine Kippa.
Wenn die Person zur Gruppe wird
Die Kippa trägt er vor allem in der Synagoge und an Feiertagen. Anfeindungen in der Öffentlichkeit hat Knappstein damit noch keine erlebt. Allerdings ändere sich sein Verhalten, wenn er die Kippa sichtbar trägt: „Ich passe schon ein bisschen mehr auf, was ich mache.“ Vor ein paar Jahren sei er an Jom Kippur, dem höchsten jüdischen Feiertag, zu Fuß in die Synagoge gegangen und hat seine Kippa getragen. „Ich kam an eine rote Ampel, bei der aber kein Auto kam – ohne Kippa wäre ich wahrscheinlich trotzdem schnell über die Straße gegangen. Mit der Kippa habe ich das nicht gemacht.“ Wenn das jemand beobachtet, würde im Kopf sofort die Verknüpfung da sein: Ah, der Jude geht über die rote Ampel. „Da werde ich nicht als Person gesehen, sondern stehe gleich für eine ganze Gruppe, was Quatsch ist.“ Knappsteins Stimme ist ernst, wenn er spricht. Er ist nicht der Einzige, der von Verallgemeinerungen und Vorurteilen berichtet.
Auch Marc Merten erzählt davon. Der Sportjournalist und Autor ist Jude und lebt in Köln. Zum Gespräch auf dem Theo-Burauen-Platz in der Innenstadt Kölns erscheint er wie auch Aaron Knappstein ohne Kippa. Merten trägt sie nur in der Synagoge. Auch wenn er in seinem Alltag nicht als Jude erkenntlich ist, ist er trotzdem ab und an mit antisemitischen Vorurteilen konfrontiert. Das eigentliche Problem dabei ist für ihn klar: „Die Vorurteile werden von den Leuten nicht als antisemitisch wahrgenommen.“ Merten berichtet von einem Freund, der beim gemeinsamen Pokerspiel zu ihm meinte: „Na klar, ist ja logisch, dass der Jude mit seinem Geld umgehen kann.“ Mertens Einstellung dazu ist klar. „In diesem Kontext war das ein vertrauter Spruch, er ist mein bester Kumpel, aber in jedem anderen Kontext würde ich das sehr kritisch sehen.“
Vorurteile existieren gegenüber unterschiedlichsten Gruppen. Das menschliche Bedürfnis, Personen und Situationen einzuordnen, um die Welt zu vereinfachen, ist unterbewusst da und schwer, komplett auszublenden. Problematisch wird es, wenn die Vorurteile aus überdauernden historischen Kontexten stammen und kaum Berührungspunkte mit der Lebensrealität der betroffenen gesellschaftlichen Gruppe haben. „Dass ,der‘ Jude angeblich gut mit Geld umgehen kann, ist eine direkte Folge des christlichen Zinsverbotes im Mittelalter. Damals durften nur Juden gegen Zins Geld verleihen. Bis heute hält sich so das Vorurteil der jüdischen Finanzherrschaft“, berichtet Merten.
Religiös, aber nicht gläubig
Merten ist mit dem Judentum groß geworden und hat sich intensiv damit auseinandergesetzt. Nach seiner journalistischen Ausbildung hat er in England Vergleichende Religionswissenschaft studiert, um vor allem über jüdische-muslimische Beziehungen mehr zu lernen. Ob er selbst religiös ist? „Ich bin religiös, aber nicht gläubig“, stellt der 39-Jährige klar. Als Kind sei die Synagoge sein zweites Wohnzimmer gewesen. An einen Gott glaube er aber nicht. „Ich sage die Segenssprüche und spreche Gebete mit, weil es für mich zur Tradition gehört, aber nicht, weil ich an etwas Übernatürliches glaube“, sagt Merten.
Jüdische Feste spielen für ihn trotzdem eine große Rolle – doch nicht wegen des Glaubens: die Feiern sind oft auch ein gemeinsames Zeit Verbringen in der Familie. „Gerade an Chanukka, unserem Lichterfest, kommen wir wieder zusammen. Auch, wenn mein Bruder und ich woanders wohnen – an Chanukka sind alle wieder daheim“, erzählt Merten, während er sich umdreht und auf den Theo-Burauen-Platz deutet. „Hier steigt der Rabbiner zu Chanukka auf die Leiter, um über dem Rathauseingang einen übergroßen Chanukka-Leuchter anzuzünden. Dazu riecht es hier auf dem ganzen Platz nach frittiertem Essen, nach Kartoffelpuffer und Krapfen.“
Für Merten hat der Theo-Burauen-Platz aber noch eine zweite Bedeutung: Als Autor machte er den Platz vor dem Rathaus während des Chanukka-Festes zum Tatort in einem seiner Thriller. Beruflich ist das für Merten aber auch schon fast der einzige Berührungspunkt mit dem Judentum. Als Sportjournalist mit dem Schwerpunkt Fußball spielt seine Religion keine Rolle. Merten lebt nicht streng religiös. Den Sabbat am Samstag als Ruhetag hält er nicht ein. „Ich berichte über die Bundesliga und den 1. FC Köln – da müsste ich ja meinen Beruf an den Nagel hängen, wenn ich samstags nicht arbeiten dürfte“, erzählt er und lacht.
Auch die Speiseregeln sieht Merten nicht so streng. „Ich esse nicht koscher, nein. Für mich bedeutet der Begriff ,koscher‘ im heutigen Kontext etwas anderes als im ursprünglichen Sinne. Ich sehe darin die Aufforderung, in der Küche reinlich zu sein, Lebensmittel sauber zu trennen, achtsam mit Essen umzugehen und nicht verschwenderisch zu leben. Und so versuche ich es zu leben.“
Und obwohl nicht streng religiös, würde er das Judentum auch seinen potentiellen Kindern gerne weitergeben. „Jüdische Traditionen sind mir wichtig. Aber ich frage mich auch: Brauchen meine Kinder dafür zwingend eine Religion? Mir als Kind hat es geholfen, dass ich automatisch mehrere Religionen kennengelernt habe: Das Christentum in der Gesellschaft und in der Schule, das jüdisch sein zuhause in der Familie“, erzählt Merten, „ich habe meine Augen früh für die religiöse Welt da außen geöffnet und früh mitbekommen, dass es mehr als einen Glauben gibt.“
Im Gespräch begegnen
Einen Austausch zwischen verschiedenen Glaubensrichtungen, Kulturen und Religionen und damit Begegnungen zwischen Nicht-Juden und jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern schaffen: Das haben sich gerade in dem Festjahr viele vorgenommen. Aber auch ganz unabhängig davon existieren bundesweit zahlreiche Initiativen, die das Ziel haben, Vorurteile aufzubrechen und lebendigen Alltag von Jüdinnen und Juden sichtbar zu machen. Eine davon ist „Meet a Jew“ – ein Projekt des Zentralrats der Juden. Die Idee dahinter ist, das aktuelle jüdische Leben durch in Deutschland lebende jüdische Menschen kennenzulernen. Sie gehen in Bildungseinrichtungen oder Vereine, sprechen dort über ihren Alltag, stellen sich Fragen und kommen so ins Gespräch mit den Gruppen.
Einer, der sich dort engagiert, ist Daniel Tarchis. Inmitten einer Oberstufenklasse würde er aufgrund seines Alters wahrscheinlich gar nicht groß auffallen. Mit seinen 20 Jahren hat er selbst erst vor wenigen Jahren die Schule beendet. Inzwischen studiert er. Bei „Meet a Jew“ hatte Daniel bis jetzt zwei Begegnungen mit Schulklassen. Dass er nah am Alter der Jugendlichen ist, sieht er als Vorteil: „Du weißt, was du erzählst, damit das für die Jugendlichen auch interessant und nachvollziehbar ist.“ Wenn Daniel spricht, hat er eine deutliche Stimme und gestikuliert mit seinen Händen. Dass die Jugendlichen seinen Erzählungen gerne folgen, kann man sich durch seine lebendigen Worte gut vorstellen. Und dass der junge Student andere begeistern kann, sowieso. Das hat Daniel schon früh gelernt.
Als Kind hat er an jüdischen Sommerfreizeiten in Bad Sobernheim teilgenommen. „Da beginnt gefühlt jede jüdische Kindheit in Deutschland“, erzählt er. Spielerisch das Judentum kennenlernen: das war vor allem das Ziel der Freizeiten. Für Daniel hatte es noch einen praktischen Nebeneffekt: „Ich glaube, es gibt keine deutsche Stadt, in der ich nicht irgendwelche Leute kenne“, erzählt er und lacht.
Jung und jüdisch
Neben den Sommerfreizeiten in der Kindheit war für Daniel ein Ereignis während seiner Jugendzeit ausschlaggebend dafür, dass er sich weiter ehrenamtlich in der jüdischen Jugendarbeit engagieren wollte: Der Besuch der European Maccabi Games in Berlin – ein europaweites sportliches Großevent, bei dem alle vier Jahre mehr als 1000 Juden und Jüdinnen aus allen europäischen Nationen in verschiedensten Disziplinen gegeneinander antreten. Daniel war 2015 live bei der Eröffnung in Berlin dabei. „Das war ein absolut umwerfender Moment. Der Augenblick, wenn alle deutschen Politiker sowohl für die deutsche, als auch die israelische Hymne aufstehen, das war für mich ein Wow-Moment – so etwas will ich erleben.“
Ein Jahr später wurde Tarchis Betreuer im jüdischen Jugendzentrum Aachen. Tätigkeiten als Leitung dort und im Vorstand von Makkabi, dem jüdischen Sportverein, folgten.
Sein ehrenamtliches Engagement im jüdischen Umfeld nimmt einen großen Platz in Tarchis‘ Leben ein. In der breiten Gesellschaft nimmt er ein anderes Bild des Judentums wahr. „Ich habe das Gefühl, dass man oft gar nicht weiß, dass aktives jüdisches Leben exisitiert.“
Bei so vielen jüdischen Ehrenämtern und Kontakten seit der Kindheit ist es nicht verwunderlich, dass Tarchis viele jüdische Freunde hat und schon immer hatte. Genauso besteht sein Freundeskreis aber auch aus nicht-jüdischen Menschen – wie zum Beispiel auch in Tarchis‘ Studium. Seine Identität als Jude spielt hier keine große Rolle. Und trotzdem findet der junge Mann sich im Studienkontext wieder im jüdischen Engagement: Tarchis engagiert sich in der JSUD, der jüdischen Studierendenunion. Ende 2016 wurde diese zum Zwecke einer gemeinsamen politischen Arbeit und Interessensvertretung junger jüdischer Erwachsene gegründet. „Wenn du als junger jüdischer Mensch eine politische Vertretung suchst, dann ist das die jüdische Studierendenunion“, erzählt Tarchis, „und dabei ist die jüdische Vielfalt extrem vorhanden: Von liberalen weiblichen Rabbinerinnen bis hin zum streng orthodoxen Juden ist da alles dabei!“ Heute ist es ein angenehmes Miteinander – sowohl innerhalb der Weltreligion, als auch zwischen den Weltreligionen. Gerade letzteres ist nicht selbstverständlich.
Nicht nur Harmonie
Besonders das Verhältnis des Christentums zum Judentum gestaltete sich nicht immer so harmonisch, wie heutzutage. Seit der Trennung der religiösen Gruppierung der Nazarener vom Judentum während des ersten Jahrhunderts entwickelte sich eine wechselvolle Beziehung: Jahrzehnte- und manchmal jahrhundertelange Phasen des friedlichen Zusammenlebens wurden immer wieder, vor allem in Krisenzeiten wie etwa Hungersnöten und Epidemien, von Unterdrückung und Verfolgung unterbrochen. Christliche Herrscher und kirchlicher Antijudaismus waren mit dafür verantwortlich, wenn die jüdische Bevölkerung als Sündenböcke herhalten musste, wenn sie als Minderheit diskriminiert, in Ghettos abgeschoben und als Außenseiter zum Opfer von Progromen wurde. Im 19. Jahrhundert entwickelte sich zusätzlich der rassistische Antisemitismus, auf dessen Grundlage die nationalsozialistische Ideologie entstehen konnte, und der in den Vernichtungslagern seinen traurigen Höhepunkt fand.
Inzwischen hat in beiden christlichen Kirchen eine intensive Aufarbeitung der historischen Schuld stattgefunden. Auch das Kolpingwerk Deutschland spricht sich ausdrücklich gegen Antsemitismus aus und hat anlässlich des Festjahres 1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland eine Erklärung mit dem Titel „Erinnerungskultur als gesamtgesellschaftlicher Auftrag“ veröffentlicht. Darin heißt es unter anderem auch, dass das gemeinsame christliche-jüdische Gespräch heute ein zentraler Auftrag sei. „Den respektvollen Dialog und die offene Begegnung mit Menschen jüdischen Glaubens zu fördern und immer wieder engagiert Stellung gegen jegliche Form von Antisemitismus zu beziehen, ist damit eine ständige Aufgabe.“
Dieser Auftrag wird im Kolpingwerk aktiv gelebt, wie es zum Beispiel auch die Kolpingsfamilie Lünen-Horstmar/Niederaden im Diözesanverband Paderborn zeigt: Sie organisierte 2018 und 2019 zwei Begegnungen mit der jüdischen Gemeinde in Unna-Massen. Auch in diesem Jahr wollte die Kolpingsfamilie den Austausch nicht ausfallen lassen und besuchte in kleinem Rahmen erneut die Synagoge.
Vielfalt erleben
Aus den Erzählungen von Daniel Tarchis, Marc Merten, Aaron Knappstein und Ruth Schulhof-Walter ist herauszuhören, wie facettenreich sich jüdisches Leben in der Gegenwart gestaltet. Alle vier teilen die Zugehörigkeit zu einer Religion und ein Stück weit auch viele Traditionen oder Bräuche miteinander. Wie sich das auf ihren Alltag und ihre Identität als Jüdin und Jude auswirkt, ist aber bei jedem und jeder unterschiedlich. Das gilt auch für die insgesamt 365 Verbote und 248 Gebote, die in der Thora stehen und die neben den Zehn Geboten im Judentum gelten. Dazu Ruth Schulhof-Walter: „Ein paar Dinge gibt es, die sind in mir fest drin. Ich würde zum Beispiel nie Schweinefleisch essen.“ Und obwohl am Sabbat kein Auto gefahren werden sollte, macht auch Schulhof-Walter diesbezüglich ab und an eine Ausnahme.
Auch für Aaron Knappstein als liberalem Juden ist klar: „Dass ich am Sabbat mit der S-Bahn fahre, macht mich nicht zum schlechteren Juden.“
Dann ist da Marc Merten, der betont: „Judentum bedeutet für mich ein Zusammenkommen in der Familie und mit offenen Augen durchs Leben gehen.“
Und zuletzt Daniel Tarchis, der sich mehr mit der jüdischen Philosophie als mit der Religion identifiziert und meint: „Ich fühle mich als deutsch-weißrussischer Jude – ich bin in Deutschland geboren, in der russischen Kultur aufgewachsen, aber das Judentum stand immer nochmal über beidem.“
Zwar haben die vier verschiedene Ansichten, sie stehen aber noch lange nicht für ein Ganzes. Vier Perspektiven von über 14,2 Millionen. So viele Juden und Jüdinnen gibt es heutzutage weltweit. Über ihre Religion, Kultur und Geschichte kann sich jede und jeder informieren. Um lebendiges Judentum jedoch kennenzulernen, kommt man an echten Begegnungen nicht vorbei. Erst mit ihnen kann der offfene Blick über den Tellerrand gelingen. Oder, wie es Marc Merten sagt: „Alles was ich kennengelernt habe, kann ich nicht mehr verurteilen, weil ich mir durch das Kennenlernen Mühe gebe, es zu verstehen. Das kann nur gut sein.“
Fotos: Barbara Bechtloff, unsplash.com/lainiebe









